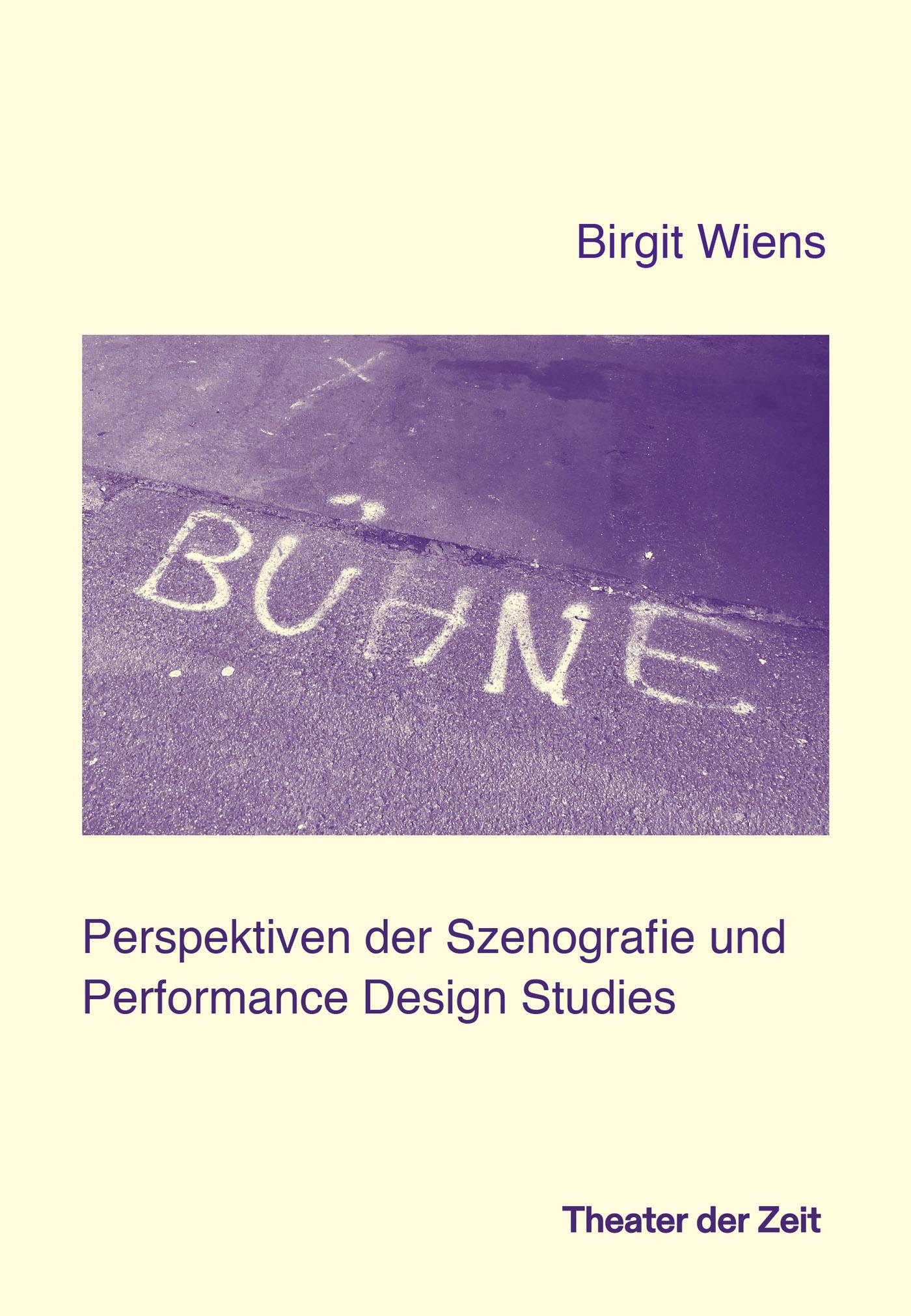Diversité Suisse
Landscapes des zeitgenössischen Theaters
von Julie Paucker
Erschienen in: Arbeitsbuch 2025: diversité suisse – landscapes des zeitgenössischen theaters (07/2025)
Assoziationen: Schweiz

Actualité
Menschen, die dieses Arbeitsbuch in Händen halten, verbindet vermutlich mindestens eine Sache: Sie lieben Theater.
Das klingt vielleicht simpel, aber in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich mehr und mehr aufspaltet, ist das bereits enorm viel. Und auf das Verbindende mehr zu achten als auf das Trennende, ist heute fast schon ein kleiner Akt des Widerstands. Man kann Theater aus sehr unterschiedlichen Gründen lieben, aber es gibt etwas an dieser Kunst, das genuin kollektiv ist. Selbst, wenn nur eine Person auf der Bühne steht, so ist sie selten allein, was die Entstehung des Stückes angeht. Und ohne Publikum macht Theater – das ist auch nach Jahrhunderten der unterschiedlichsten Prüfstände inklusive einer Coronakrise immer noch ziemlich klar – einfach wenig Sinn.
Dieses Gemeinsame des Moments einer Vorstellung ist ein Ja zur Begegnung, zur Auseinandersetzung, ein Ja zu geteilten Räumen, zur kollektiven Reflexion, zur Literatur, zur Fantasie und zu gedanklichen Umwegen; dazu, sich gemeinsam an einem Ort, zu einer Zeit, auf einen oft recht anachronistisch analogen Vorgang einzulassen, dessen Ausgang offen ist.
Wir wissen noch gar nicht, was das in einer immer virtueller – künstlicher – werdenden Welt bedeuten wird. Möglicherweise wird es eher noch existenzieller. Das Theater wird weiterhin auch Wege des Virtuellen mitgehen, natürlich, Theater ist Bewegung, Reaktion, Spiel, Variation und Widerständigkeit. Nichts daran ist fest. Aber ich glaube nicht, dass die zentralen Aspekte der Gemeinsamkeit, der Kollektivität und ja, auch des Analogen, sich erübrigen werden.
Das allein hat, so bin ich überzeugt, eine große Kraft. Eine subversive Kraft. Die „Feinde der Demokratie“ scheinen das manchmal fast besser zu wissen als wir, die wir das Theater lieben oder es „machen“. Eine der ersten Handlungen einer Regierung, die versucht, Macht zu konzentrieren und Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben, ist, dass sie der Kunst die Luft abdreht. Mit Geld, mit Personalentscheiden. Und dafür gibt es Gründe.
Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Die Erschütterungen im Stadttheaterbetrieb, die durch die #MeToo-Debatte, Machtmissbrauchs- und Diversitätsdiskussionen ausgelöst worden sind, die Umweltkrise, der nicht enden wollende Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt – diese Themen haben das Theater in der Schweiz natürlich nicht unberührt gelassen. Sie haben im Gegenteil zu tiefgreifenden Änderungen geführt – und der Prozess ist längst nicht abgeschlossen.
Noch vor ein paar Jahren fühlten wir uns hierzulande untouchable, dass irgendeine Krise einmal wirklich hier ankäme, so richtig haben wir es nicht geglaubt. Das ist heute mit Sicherheit anders, selbst wenn es uns –Schweizer Künstler:innen finanziell und strukturell immer noch besser geht als den meisten Kolleg:innen in anderen Ländern, und das beginnt bei unseren direkten Nachbarn.
Dieses Näherkommen der Einschläge treibt die Schweiz – und auch die Schweizer Kunst – zunehmend aus ihrem kleinen, verschnörkelten, fröhlichen und skurrilen Schneckenhaus, in dem sie sich bisweilen aufhält und in welches die Erschütterungen des Weltgeschehens zwar vordringen, jedoch immer etwas verspätet, gedämpft und schon dreimal im Kreis gedreht.
Seither werden, so scheint mir, andere Geschichten erzählt. Stücke werden anders besetzt, Ensembles diverser zusammengestellt. Das Publikum inklusiver gedacht. Ein Theater, das nah an der Realität, nah am darstellenden Menschen ist, aber auch nah an politischen und wissenschaftlichen Diskursen, drängte in den letzten Jahren literarischere, geschlossenere oder fiktionalere Formen in den Hintergrund. Wo vor Kurzem noch die Klimakrise auf den Schweizer Bühnen in allen Landesteilen das präsenteste Thema war, fanden in den letzten beiden Jahren vermehrt Fragen nach der eigenen Identität, Formen der autobiografischen Spurensuche, dokumentarische Herangehensweisen der Auseinandersetzung mit sozialen Rollen, Diskriminierungen, Privilegien oder Schicksalen ihren Weg auf die Bühnen vor allem der Freien Szene. Diese ästhetischen Umbrüche prägten aber entschieden auch die Spielpläne der Stadttheater oder der weniger innovativen großen Gastspiel- und Produktions- oder Ko-Produktionshäuser, die aufgrund ihrer herkömmlichen Aufgabe, sich auch mit älteren Texten (oder überhaupt mit Texten) auseinanderzusetzen, den Clash dieser ästhetischen Revolution mit tradierten Formen der Besetzung und der Repräsentation in viel expliziterer Weise austragen mussten – und müssen. Gegenüber diesen Häusern besteht vonseiten des Publikums meist eine festere Erwartung, als das in der Freien Szene der Fall ist. Gleichzeitig müssen sie strukturell größere Publikumssektoren „bedienen“ als kleinere, freiere und weniger subventionierte Orte.
Diese inhaltlichen und ästhetischen Wandlungen leiten sich aus Debatten ab, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, wie Macht- und Rollenverhältnisse, Teilhabe und die schwarze Zukunft unseres Planeten. Sie sind geprägt vom Mindset der aktiven Künstler:innen, den Theaterleitungen und den Programmverantwortlichen. Aktuell sind sie, wie immer mal wieder, auch sehr geprägt von den Themen, die junge Menschen, welche die Theaterszene neu betreten, einbringen. Oder von Themen, die Menschen mit auf die Bühnen bringen, deren Stimme bisher wenig gehört wurde. In nicht zu unterschätzender Weise resultieren sie aber auch aus einem Umdenken der Förderinstitutionen, die ja nicht nur unterstützen, sondern mit ihren Förderkriterien auch Einfluss nehmen.
Dem Theatergeschehen drohte bisweilen vielleicht der Humor etwas abhandenzukommen. Ein neuer Ernst, eine wenig poetische Explizitheit und moralische Töne waren zu hören, was sonst auf Schweizer Bühnen eher selten war. Fast war es so, als würde im Hintergrund eines jeden Stückes eine unheimliche Melodie spielen, die bedeute: Kunst allein reicht nicht mehr, Freund:innen, ihr müsst schon sehr eindeutig begründen, warum ihr auf der Bühne steht und (subventioniertes/gefördertes) Theater macht.
Vielleicht zeugt das von einer größeren Achtsamkeit gegenüber dem, was wir (an Vielfalt und Wohlstand) immer noch haben, aber auch gegenüber dem, was anderen und uns gerade zustößt oder noch zustoßen kann.
Auch auf struktureller Ebene hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ein neu erwachtes Interesse der Szene, sich besser zu vernetzen, um gemeinsam Themen vertreten zu können, ist feststellbar. Gesamtschweizerische Netzwerktreffen nehmen zu und werden von den Theaterschaffenden auch wahrgenommen. Theaterstrukturen werden kritisch betrachtet und neu gedacht, Branchengewohnheiten, die zu lange einfach als gegeben gegolten haben wie Arbeitsökonomie, Produktionsrhythmen, Richtlöhne (t. Theaterschaffen Schweiz1), Touring-Systeme werden infrage gestellt (Études Rota 20222), es werden neue Kooperationsmodelle erfunden, Tools für nachhaltigeres Arbeiten3 angeboten, es gibt Online-Plattformen, die den Tausch von Theatermaterial ermöglichen oder sinnvolle, nachhaltigere Tourneekooperationen4 befördern. Auch hier spielen Förderinstitutionen wie M2Act (Migros-Kulturprozent) oder Pro Helvetia eine wesentliche Rolle.
Im Laufe der letzten zehn Jahre ist der Anteil von Frauen in Leitungspositionen in den Theatern der Schweiz wesentlich gestiegen, so dass er mittlerweile bei fast 50 Prozent liegt, mit Abstrichen bei den ganz großen Häusern. Theater und Ensembles sind also insgesamt kollektiver, weiblicher, inklusiver und diverser geworden. Ob diese Tendenz Bestand haben wird, wenn auch hier die Mittel bald knapper werden, wird sich weisen.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass das Theater ästhetisch wie strukturell in den letzten Jahren – und verschärft während und nach der Coronakrise – wenig festen Bühnenboden unter den Füßen hatte. So dass es manchmal einem Eiertanz glich, bisweilen auch einem Hochseilakt über einem tiefen, nicht weiter präzisierten Abgrund. Oft strauchelte es suchend und unbeholfen, jedoch immer wieder findet es aktuell, so scheint mir, zu einer wirklich neuen, aktuellen, noch zarten, aber vielversprechenden Stimme. Einer vielstimmigeren, diverseren Stimme als bis anhin. In letzter Zeit kehrt auch das Narrative wieder etwas mehr zurück, Autor:innen, vor allem solche, die nah an den Theaterprozessen sind, gewinnen wieder an Bedeutung, es wird wieder verspielter, fiktionaler – auch wieder ein bisschen lustiger. Aber, so scheint mir, mit sehenderen Augen. Das Performative schwappt ins Spielerische und das Spielerische ins Performative, beides kann mehr und mehr nebeneinander bestehen.
Diese Wandlungen sind in vollem Gange, die Perioden, in denen sie sich vollziehen, sind kürzer als in ruhigeren Zeiten. Die Ursachen dafür sind oft brutal und wenig amüsant, aber ästhetisch ist es hochinteressant, weil Theater immer dann am spannendsten ist, wenn es sich neu erfindet.
Multilinguisme
Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land. 61 Prozent der Bevölkerung sprechen Deutsch beziehungsweise Schweizerdeutsch, 23 Prozent Französisch, 8 Prozent Italienisch und 0,5 Prozent sprechen als Erstsprache Rätoromanisch. Ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung (24 Prozent) spricht außerdem eine Hauptsprache, die keine der vier Landessprachen ist, in erster Linie ist das Englisch (6 Prozent), dann Portugiesisch (3 Prozent) oder Albanisch (3 Prozent). 17 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind zweisprachig, 39 Prozent sprechen mehr als zwei verschiedene Sprachen am Arbeitsplatz. Die letzte nationale Statistik wurde 20235 erhoben.
Die Mehrsprachigkeit prägt die Schweizer Theaterszene als eine Theaterlandschaft entscheidend. Sprache trennt auch im Theater noch immer, vor allem natürlich in den Formen, wo sie eine wesentliche Rolle spielt. Mindestens ebenso aktiv arbeiten jedoch Medien, Communitys, Gewohnheiten, aber auch Systeme der Entlohnung, der Ausbildung, der Förderung und des Marktes daran, die Szenen in den Sprachregionen weiterhin zu sortieren und voneinander abzugrenzen. So gelingt es nicht einmal sprachferneren Formen der Darstellenden Künste ohne Weiteres, die Grenzen zwischen den Sprachregionen zu überqueren. Dementsprechend hat sich das Theater in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich entwickelt und ist voneinander unabhängigen Einflüssen ausgesetzt. Die Sprachregionen orientieren sich oft stärker an dem ihnen zugehörigen (außerschweizerischen) Sprach- und Kulturraum – also die Romandie an Frankreich, das Tessin an Italien und die deutschsprachige Schweiz an Deutschland und Österreich – als an dem des eigenen Landes. Der Austausch zwischen den Sprachregionen nimmt zwar auf künstlerischer und professioneller Ebene in letzter Zeit endlich spürbar zu, und doch existieren die Szenen nach wie vor weitgehend unabhängig voneinander. Alle begreifen sich jedoch fraglos als Teil einer Schweizer Theaterszene. Dies, obwohl die Internationalität weiterhin zunimmt: Immer mehr Theatergruppen begreifen sich als grenzübergreifend, die Stadttheaterszene ist vollkommen durchmischt mit Künstler:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, in der Romandie gilt Ähnliches für französische Künstler:innen, die vor allem in Genf und Lausanne arbeiten, Romand.e.s erobern in jüngeren Jahren, auch dank Einrichtungen wie der Sélection Suisse en Avignon, Stück für Stück ihren Platz im französischen Markt. Im Tessin gibt es eine rege italienischsprachige und internationale Szene im Bereich physical theatre,6 doch eine Ausbildung für italienischsprachiges Sprechtheater gibt es nicht in der Schweiz, so dass Theater und junge Künstler:innen auf den Austausch mit Italien angewiesen sind. Hier gilt ähnlich wie für die Romandie, dass der Austausch weniger gleichberechtigt ist als im deutschsprachigen Raum. Heißt: Französ:innen arbeiten hier und leiten Theater, umgekehrt ist das aber noch weniger der Fall, das Gleiche kann man für italienische Künstler:innen in der Schweiz und Tessiner Künstler:innen in Italien sagen. Im rätoromanischen Sprachraum gibt es keine Hochschule für Theater und auch kein Nachbarland, wo dieselbe Sprache gesprochen würde, entsprechend sind Schauspieler:innen aus dieser Region auf eine Zweitsprache angewiesen. In der Folge gibt es nur sehr wenig professionelles Theater in Rätoromanisch. Rund ums Theater Chur gab es jedoch in den letzten Jahren vermehrt Versuche, die Sprache auf der Bühne mit einzubeziehen.
Internazionalità nazionale
So bestehen auf diesem kleinen Raum, der die Schweiz ist, Theaterformen nebeneinander, die sich voneinander unterscheiden wie sonst nur die Theaterformen verschiedener Länder. Man könnte sagen, es gibt eine Art nationale Internationalität des Theaterschaffens in der Schweiz.
Dieser Widerspruch macht es so spannend, sich mit Schweizer Theater zu beschäftigen. Im Theaterschaffen der Schweiz bilden sich ähnliche Phänomene ab wie in einer internationalen Szene.
Eine bessere Kenntnis der jeweils „anderen“ Schweizer Theaterszenen böte Theaterschaffenden und Künstler:innen die Möglichkeit, im eigenen Land eine riesige Palette an Theaterkonzepten zu erfahren und kennenzulernen. Das richtige Theater, die richtige Theaterform gibt es nicht, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen – jedes System hat – auch je nach Zeit und Kontext – seine Stärken und seine Schwächen, seine Glanzmomente und seine Trauerspiele. Dies zu erkennen, zu analysieren und möglicherweise besser zu kombinieren ist eines der riesigen Potenziale des Schweizer Theaters, es ist längst noch nicht ausgeschöpft.
Chacun.e dans sa propre langue
Gemäß dem urschweizerischen (aber auch im europäischen Parlament angewandten) Prinzip: „Chacun.e dans sa propre langue!“ sind in diesem Arbeitsbuch alle Artikel zuerst in ihrer Originalsprache abgedruckt. Wo diese nicht die deutsche Sprache ist, sind sie zusätzlich ins Deutsche übersetzt. In der nächstgrößer vertretenen weiteren Landessprache findet sich jeweils eine kleine Summary, die den Inhalt des Artikels kurz zusammenfasst. Da viele Menschen eine deutlich höhere Sprachkompetenz haben, als sie selbst denken, haben wir uns erlaubt, ein paar Kleinigkeiten auch einfach nicht zu übersetzen.
1 https://www.tpunkt.ch/richtloehne
2 https://corodis.ch/corodis/etude-rota-2022/
3 Z. B.: https://www.vertlefutur.ch
5 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html
6 Dank der Accademia Dimitri in Verscio, einer Hochschule mit diesem Schwerpunkt.