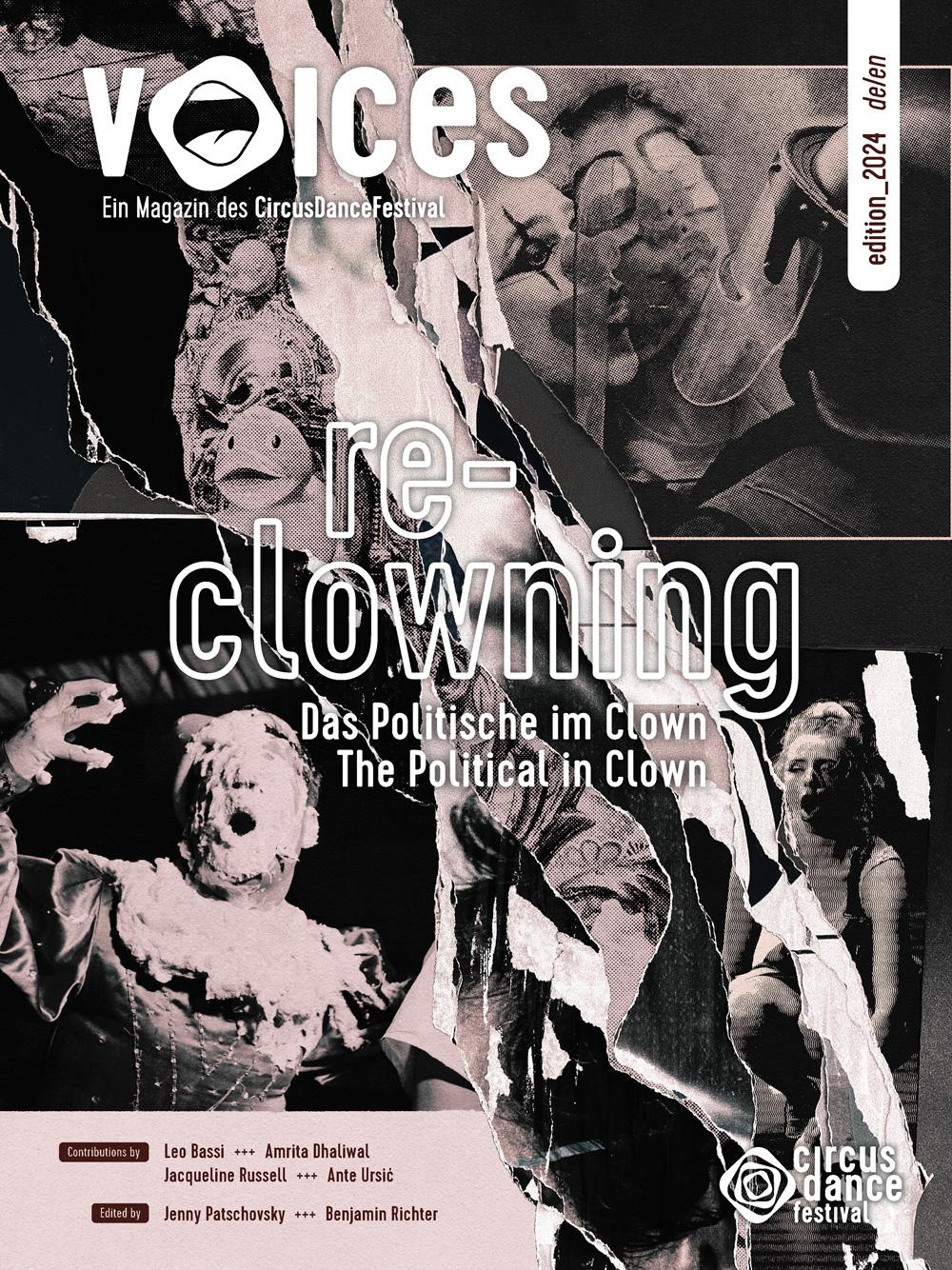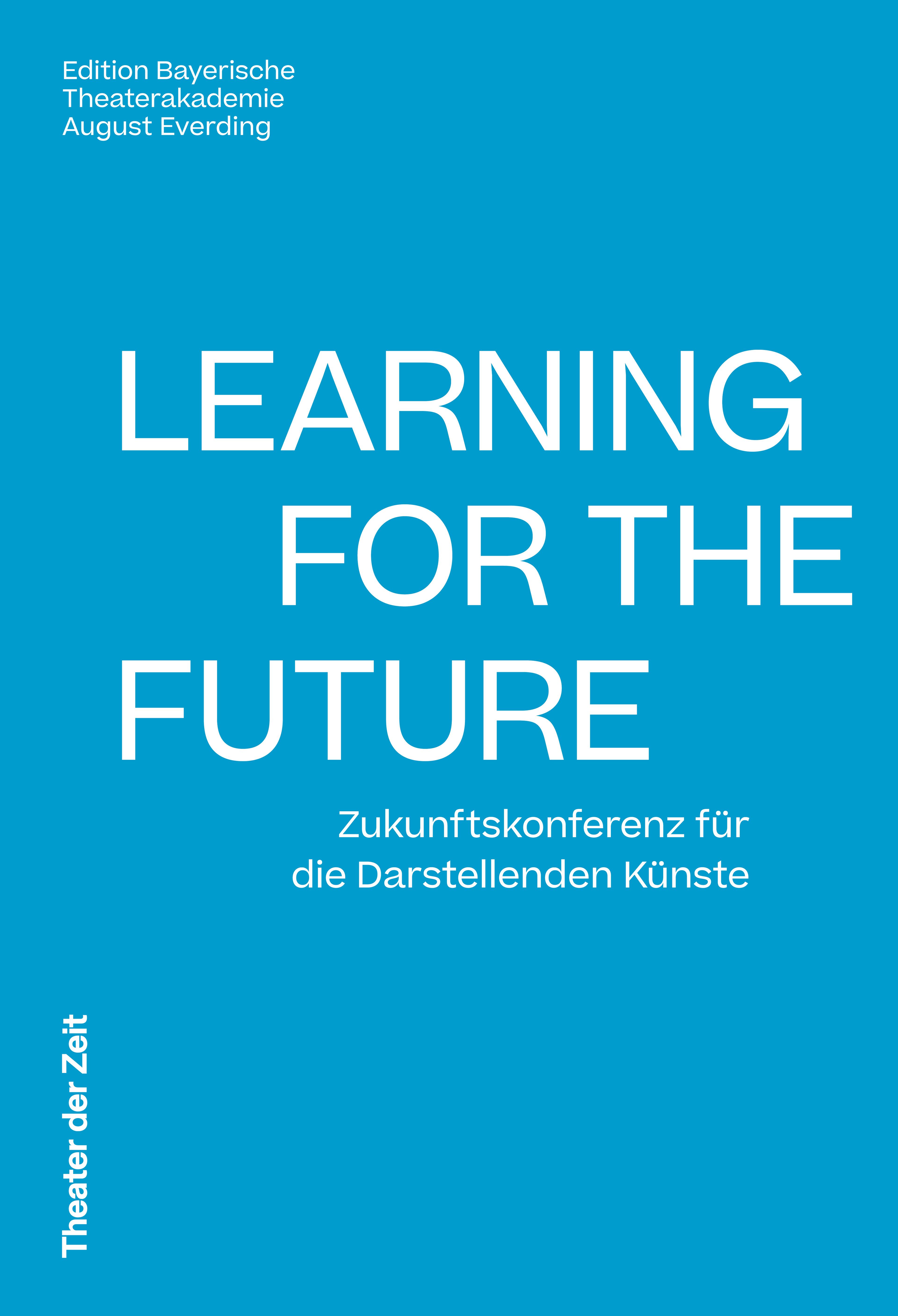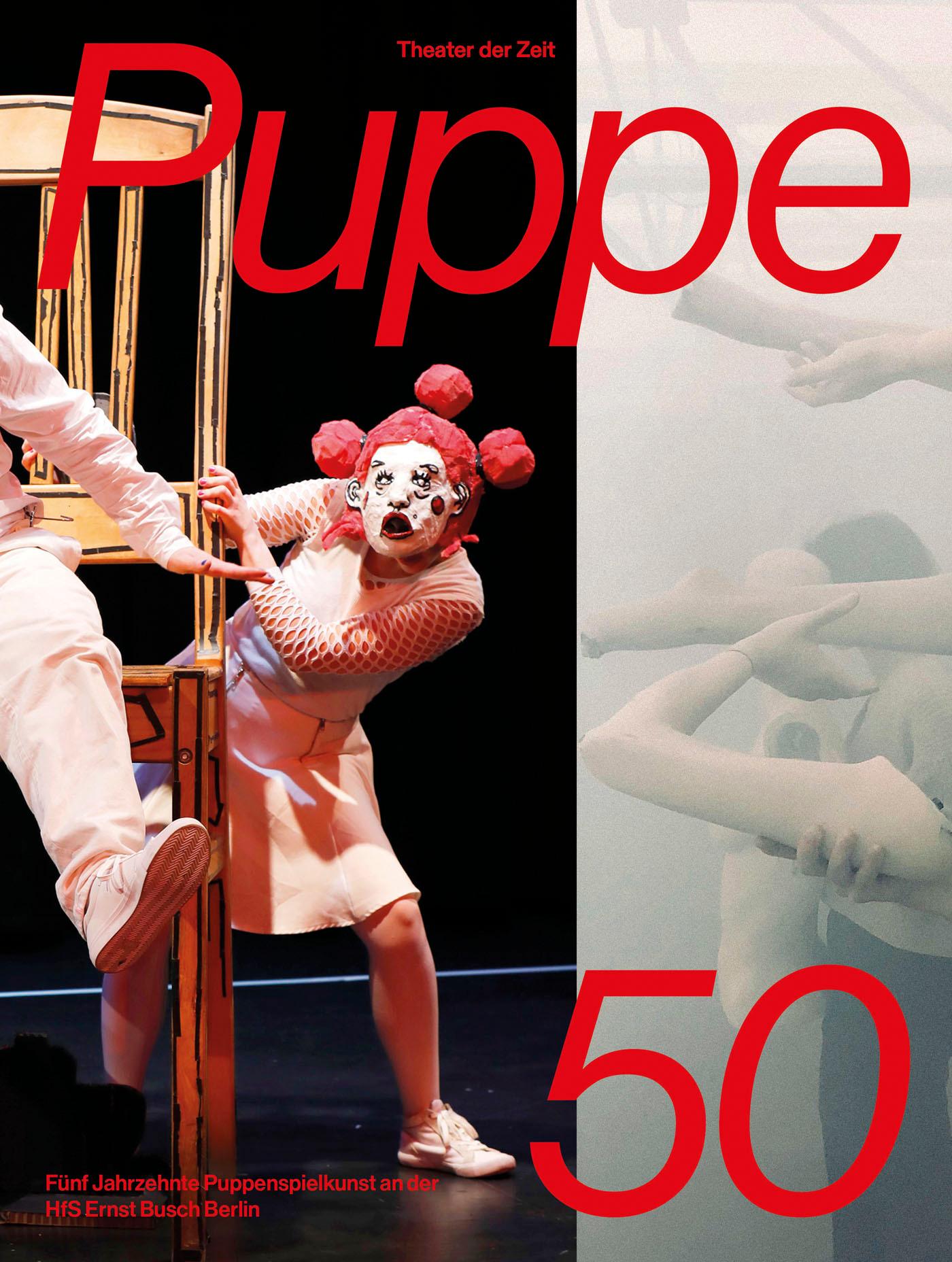Auftritt
Theater an der Effingerstrasse Bern: Der Goliath von Rechtsaußen ist verletzbar
„Der vergessene Prozess“ von Gornaya (UA) – Regie Jochen Strodthoff, Bühne und Kostüme Angela Loewen, Musik Robert Aeberhard
von Frank Schubert
Assoziationen: Theaterkritiken Schweiz DAS Theater an der Effingerstraße, Bern

„Sprache ist die Waffe, die trifft.“ Das Publikum wird mit diesem Satz begrüßt und schnell wird klar, dass sich hier niemand zurücklehnen kann, auch wenn die Kostüme in die 30er-Jahre weisen und die Musik nur dezent einen Kosmos zwischen jüdischer Musik und der Marschmusik damaliger Wochenschauen umreisst.
1933 strengten der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und die Israelitische Kultusgemeinde einen Prozess gegen den aufstrebenden Nationalsozialismus in der Schweiz an. Im Zentrum stand der Nachweis, dass die an jedem Kiosk erhältlichen „Protokolle der Weisen von Zion“ gefälscht waren, um angebliche Weltherrschaftsambitionen des Judentums zu untermauern. Im Kern ging es im damals international stark reflektierten und heute vergessenen Mammutprozess um Wahrheit oder Lüge, um die Wirkkräfte von Verschwörungstheorien und Fakenews. Es erschüttert, dass der Erfolg des Prozesses nur von kurzer Dauer war.
Die Schweizer Autorin Gornaya arbeitet diesen Prozess für das Theater auf, verwendet in ihrem Text größtenteils Originalzitate und kommt dabei ohne platte Aktualisierungen und Anleihen aus aktuell-politischen Vorgängen aus. Es verblüfft, wie konkret dennoch Formulierungen und Wortwahl des gesamten modernen rechten Spektrums aus dem Material des Berner Prozesses herausschallen.
Das Theaterkollektiv engagiert sich stark für das Material und dieses Ringen findet auf der Bühne eine Form. Das Publikum im Saal spürt, dass heute wieder ein Goliath von Rechtsaußen erstarkt. Es weiß, dass die Schweizer Politik gerade wieder um ein Verbot von Nazisymbolen ringt und ein Vertreter der stärksten Schweizer Partei, der SVP, in der Debatte ernsthaft zu bedenken gibt, dass es ein zu großer Eingriff in die persönlichen Freiheiten sein könnte, würde man etwas verbieten, was man „mit seinem Körper tut“ und „irgendeine Behörde“ daran „eine Gesinnung festmacht“. Gemeint ist der Hitlergruß.
Aber auch der schnelllebige Zeitgeist greift in die Auseinandersetzung ein. Darf sich das Ensemble Texte und Haltungen jüdischer Mitbürger zu eigen machen? Die Debatten aus den 30er-Jahren könnten auch heute Menschen wieder verletzen. Darf man das ohne einen Strauß von Triggerwarnungen? Das Ensemble entscheidet sich für ein Theater, das auch ein Ort schmerzhafter Auseinandersetzungen zu sein hat, es übernimmt Verantwortung und macht das eigene Ringen öffentlich. So wird dieses Theater zu einem Forum der Auseinandersetzung, ohne sich hinter einer vierten Wand zu verstecken. Die Inszenierung gibt den Haltungen der Spielerinnen und Spieler Raum und Gewicht.
Jeroen Engelsman führt mit dem Textmaterial des jungen Anwalts Georges Brunschvig, der die jüdischen Kläger 1933 vertrat, durch den Bühnen-Prozess. Die Grande Dame der Schweizer Bühne und des Films Heidi Maria Glössner konzentriert sich fast ausschließlich auf die Figur der Odette Brunschvig, die ihren Mann lange überlebte und übernimmt eindringlich und mit dem ganzen Gewicht ihrer historischen Erfahrung den Part der aktiven Erinnerung. Tobias Krüger, Kornelia Lüdorff und Wowo Habdank wechseln im Minutentakt die Rollen, skizzieren mit wenigen Mitteln die unterschiedlichen Prozessbeteiligten und geben mit leichter Hand dem Prozessverlauf über zwei Stunden hinweg eine spannende Kontur. Regie, Ausstattung und Musik beschränken sich auf das Notwendige, um dem Zeitdokument Schärfe, mitunter Verspieltheit und Emotionalität, aber immer eine Anbindung an die Gegenwart zu geben. Die Inszenierung macht die drohenden Abgründe der Gegenwart schmerzhaft spürbar und damit ist nicht allein ein marschierender Antisemitismus gemeint. So steht ein eindringlicher Appell für die Bewahrung der Demokratie am Schluss und die Utopie, dass das Undenkbare möglich werden könnte. Heidi Maria Glössner entlässt uns mit einem „Schalom und Salam“.
Erschienen am 26.4.2024