Im Abseits. Theater schreiben
von Ulrike Haß
Erschienen in: Kraftfeld Chor – Aischylos Sophokles Kleist Beckett Jelinek (01/2021)
Assoziationen: Theatergeschichte
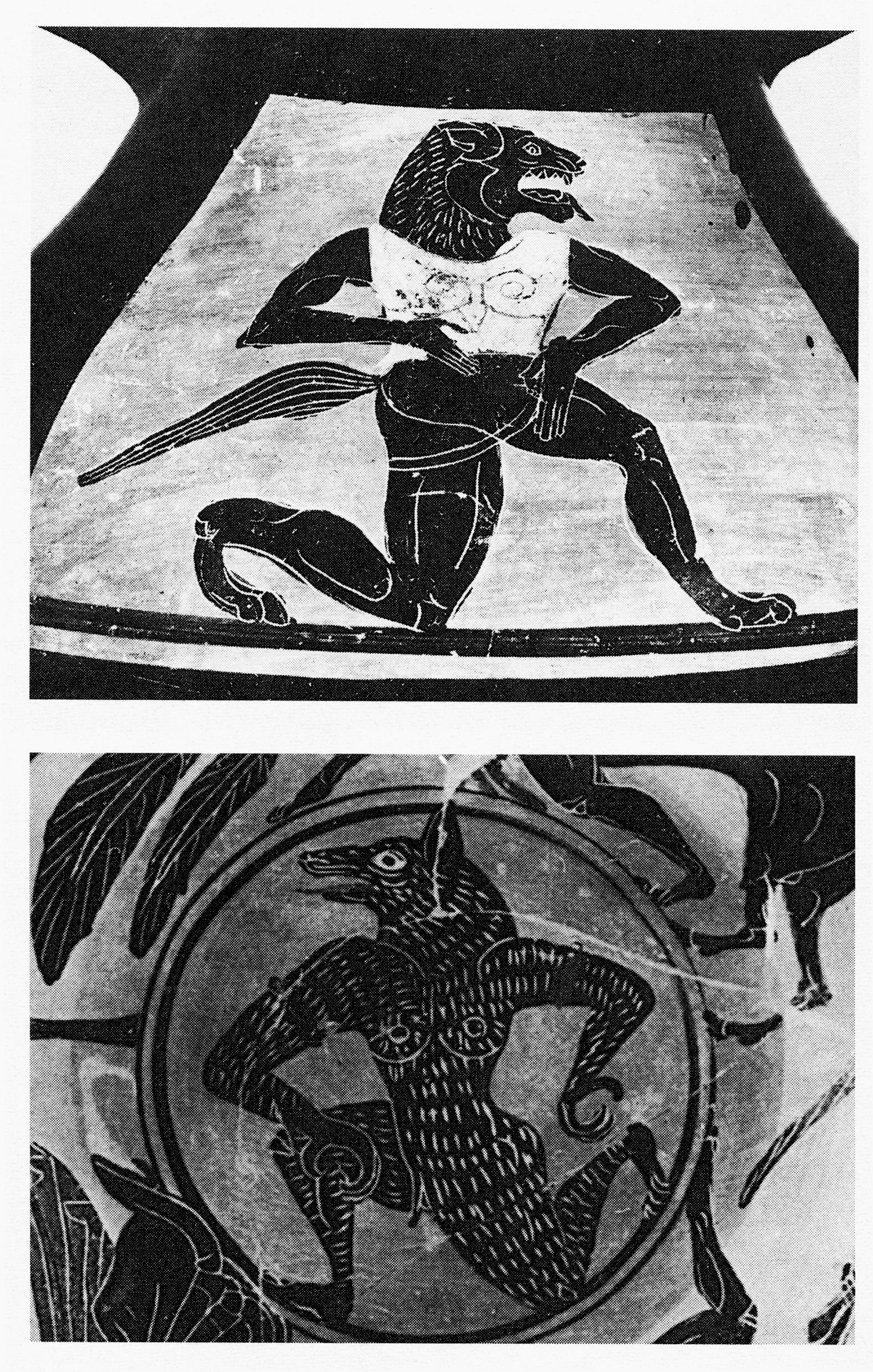
Wie entdeckt Jelinek den Chor? Wie entstehen Jelineks chorisch-monologische Suaden mit ihren fluiden, wechselhaft gegeneinander und ineinander übergehenden Sprecherinstanzen? Mit ihren abrupten Wechseln zwischen Ich und Wir, ihren unvermittelt dazwischenfahrenden Anreden: hören Sie! Woher dieses unverwechselbare Glissando ihrer Sprache? Ich glaube, es ist die weggeworfene Rolle Frau, aus der alle weiteren Schritte hervorgingen. Weder logisch noch folgerichtig, sondern durch ein Ereignis, das sich rhizomatisch ausbreitet und alle Fragen in mikrologischer Manier erfasst. Dieser schon zu Beginn unerbittlich geschürzte Knoten hat weiterhin mit einem Merkmal dieses Werks zu tun, welches in der inflationären Rede von den Textflächen immer wieder unterzugehen scheint: Nämlich, dass dieses Werk von der Frage des sprechenden Körpers aus insistiert. Dieser Körper ist als geschlechtlich zwanghaft identifizierter Körper, als Rollenkörper und als vermeintlich natürliches, unentgeltliches Beiwerk irgendeines Erscheinens verworfen, aber als Frage des sprechenden Körpers ist er nicht erledigt. Als Körper auf einer Bühne, aber auch als Gegenstand einer niederen Mimesis und eines alltäglichen Wissens sind (Chor)Körper nicht verworfen.
Leisten Intertexte wirklich die ganze Arbeit?
In vielen Kommentaren scheint es so, als würden Jelineks Textflächen derart ausufern, weil es die Wirklichkeit in den social media news, Nachrichten und Liveticker selbst tut. Als „eine ‚Moralistin‘ der schlechten Wirklichkeit“...


.jpeg&w=3840&q=75)















