Das Guiskard-Fragment
von Ulrike Haß
Erschienen in: Kraftfeld Chor – Aischylos Sophokles Kleist Beckett Jelinek (01/2021)
Assoziationen: Theatergeschichte
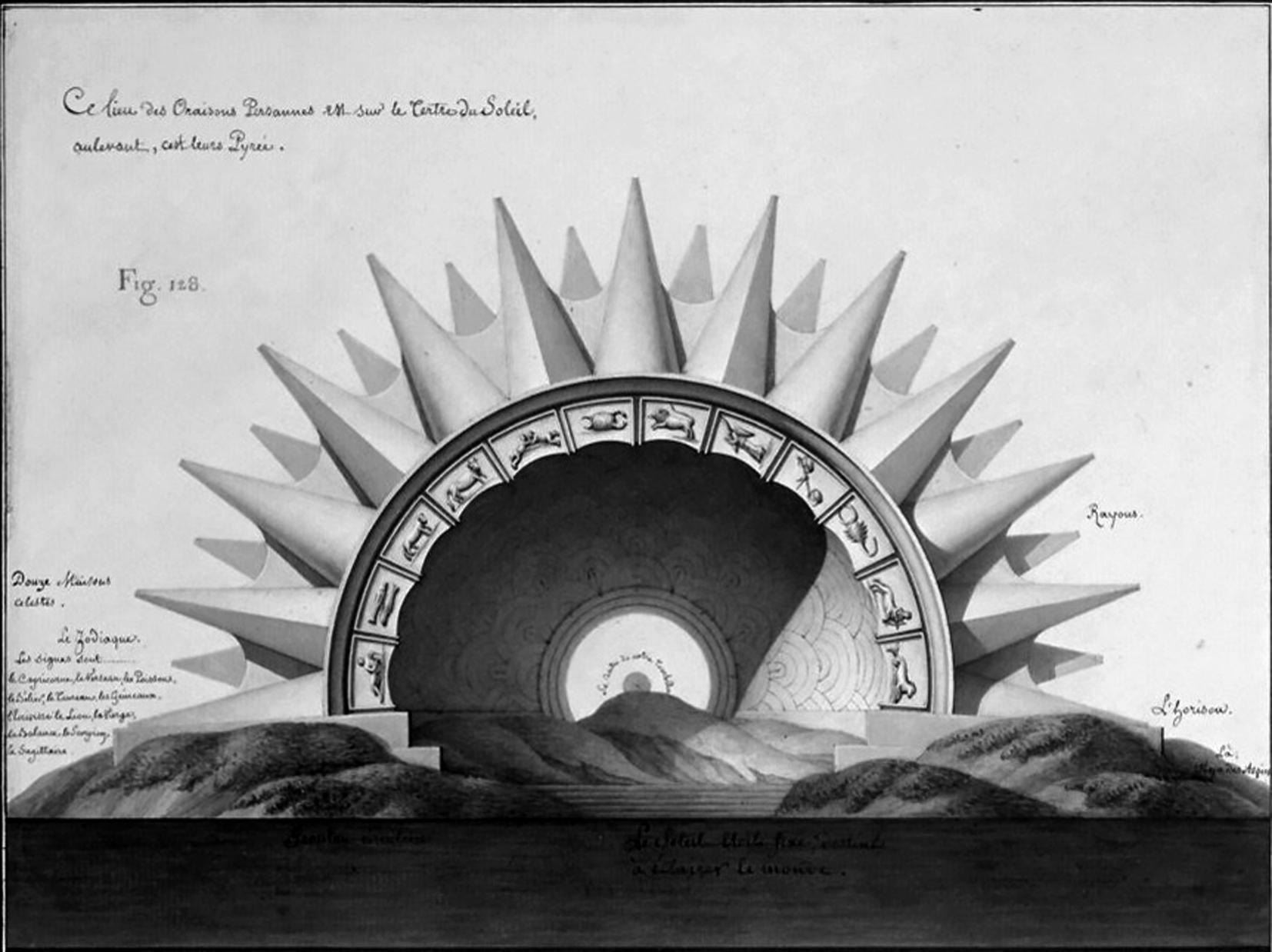
Im Doppelheft April/Mai 1808 wird das Guiskard-Fragment in der von Kleist und Adam Müller herausgegebenen Zeitschrift Phoebus. Ein Journal für die Kunst veröffentlicht. Kleists Kämpfe um dieses Stück, über die er sich brieflich mitteilte und Wielands enthusiastischer Bericht über den Vortrag, den ihm Kleist 1803 aus dem Guiskard machte, haben Vermutungen über „die unausführbare Tragödie“ (Bernhard Greiner)166, aber auch überschwängliche Begeisterung über die „vollendete Unvollständigkeit“ (Thomas Mann)167 dieses Fragments ohne Ende hervorgebracht. Der Abbruch eines Fragments, der ohne Übergang in eine arktische Zone leitet, in der jede Orientierung aussetzt, wird als Zumutung wahrgenommen. Das denkende, lesende Ich fühlt sich zur Gegenwehr aufgerufen und versucht zu ergänzen, zu urteilen oder illusionär zu schließen, was im Abbruch des Fragments mit der Kraft des Zufalls aufklafft in das, was sein kann oder auch nicht sein kann. Daher werden wir, wenn wir es an dieser Stelle mit Roland Reuß halten, der Karl August Böttigers Rezension aus dem Juni 1808 zitiert: „Über das Ganze läßt sich aus dem kein Urtheil fällen, was hier vor uns liegt“168.
Was vor uns liegt, besteht aus einem Bild („Scene“) und 524 Versen. Dazu kommen die Untergliederung in zehn Auftritte sowie Sprecherangaben, Szenenanweisungen und...















