Georg Kasch: Seit einem Jahr klicken wir uns alle durch Streams und Online-Formate. Wenn man Glück hat, ist das solides bis gut abgefilmtes Theater. Wenn man Pech hat, dann scheppert der Ton, die Gesten der Spieler*innen sind zu groß für die Kamera und alles, was einem im Saal schon stören würde, nervt vielleicht doppelt und dreifach, weil es zu laut, zu verzerrt oder irgendwie seltsam ist. Die meisten Theater und Gruppen waren offenbar überfordert mit dem plötzlichen Medienwechsel während der Pandemie – aber es gab und gibt auch viele rühmliche Ausnahmen, denen es gelungen ist, die theatertypische liveness und die Möglichkeiten des Internets zusammenzudenken. Dazu zählen auch die Arbeiten, über die wir uns heute unterhalten werden: der Zoom-Abend Challenge accepted:Ich bin der Schauspielerin, Tänzerin, Autorin und Inklusionsberaterin Jana Zöll; Manila Zoo, eine Produktion der philippinischen Choreografin Eisa Jocson, die von Anna Wagner, Dramaturgin am Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm, betreut wurde; und die hybride Instagram-Bühnen-Inszenierung _jeanne_dark_ der französischen Autorin, Regisseurin und Performerin Marion Siéfert. Zunächst mal eine große Frage am Anfang: Was ist für euch Theater?
Jana Zöll: Ich finde den Live-Aspekt, den du bereits betont hast, extrem wichtig, etwa im Unterschied zum Film. Aber natürlich ist diese liveness gerade jetzt...

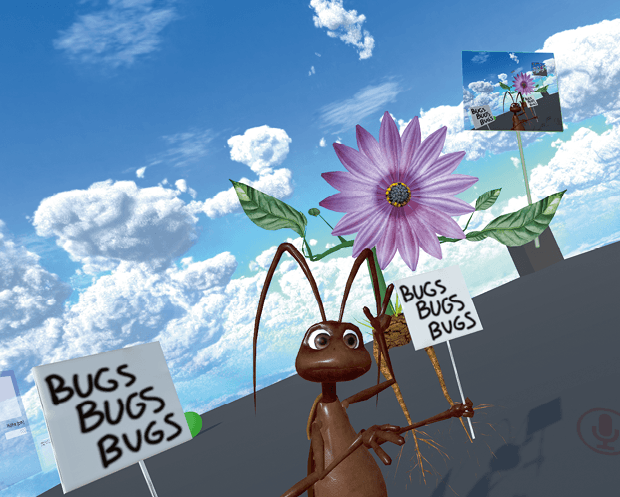
.jpeg&w=3840&q=75)















