Können Sie Homeoffice?1 Der Schreibtisch in den eigenen vier Wänden ist eine Herausforderung. Immer wieder wird die Work-Life-Balance und das Abschalten nach einem Arbeitsalltag durch die digitale Erreichbarkeit boykottiert. Seit der Erklärung des COVID-19-Ausbruchs zur Pandemie durch die WHO am 11. März 2020 sind die Grenzen zwischen Job und Privatleben fließend. Die Vor- und Nachteile der Heimarbeit werden volatil diskutiert. Im Januar 2021 publizierte deutschlandfunk nova Tipps gegen den Lockdown-Wohnungskoller von einer Astronautin, einer Expertin für engste und dauerhafte Raumsituationen.2 Die Astronautin Suzanna Randall empfiehlt, Routinen zu planen und (endlich) vernachlässigten Hobbys nachzugehen. Das Homeoffice, das zeigt die aktuelle Debatte, ist sowohl eine Revolution als auch ein Problem für das Verständnis von Arbeit.
Die Diskussion offenbart (mindestens) drei Aspekte der Arbeitswelt: Es gibt Berufsgruppen, die ihre Tätigkeit nicht im Homeoffice ausüben können und in der Gesundheitskrise eine existentielle Bedrohung erfahren. Es gibt Haushalte oder Personengruppen, die nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um sich den eigenen Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Und es gibt Care-Arbeit, verstanden in der englischen Mehrdeutigkeit als fürsorgliche Praxis, Sorge- und Reproduktionsarbeit, die in der Pandemie überdeutlich als zentraler Motor des gesellschaftlichen Wohlergehens Sichtbarkeit erlangt – eine (oft unterbezahlte oder ganz und gar...


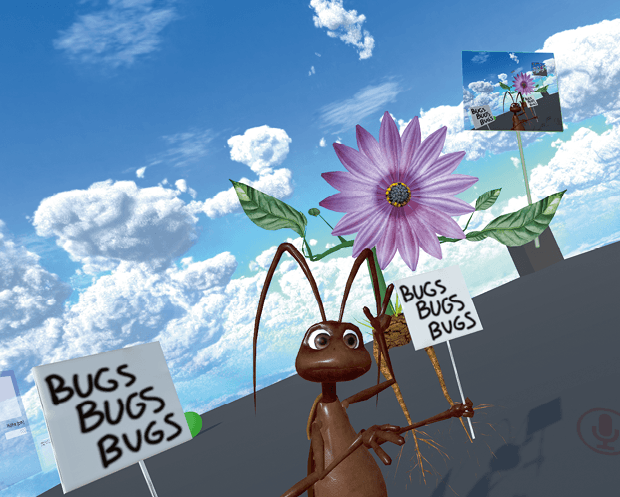

.jpeg&w=3840&q=75)















