Magazin
Das Reform-Genie
Stephen Hintons monumentale Studie erfasst Kurt Weills Musiktheater
von Thomas Irmer
Erschienen in: Theater der Zeit: Konfliktzone – Theater in politischen Auseinandersetzungen (04/2024)
Assoziationen: Buchrezensionen Musiktheater
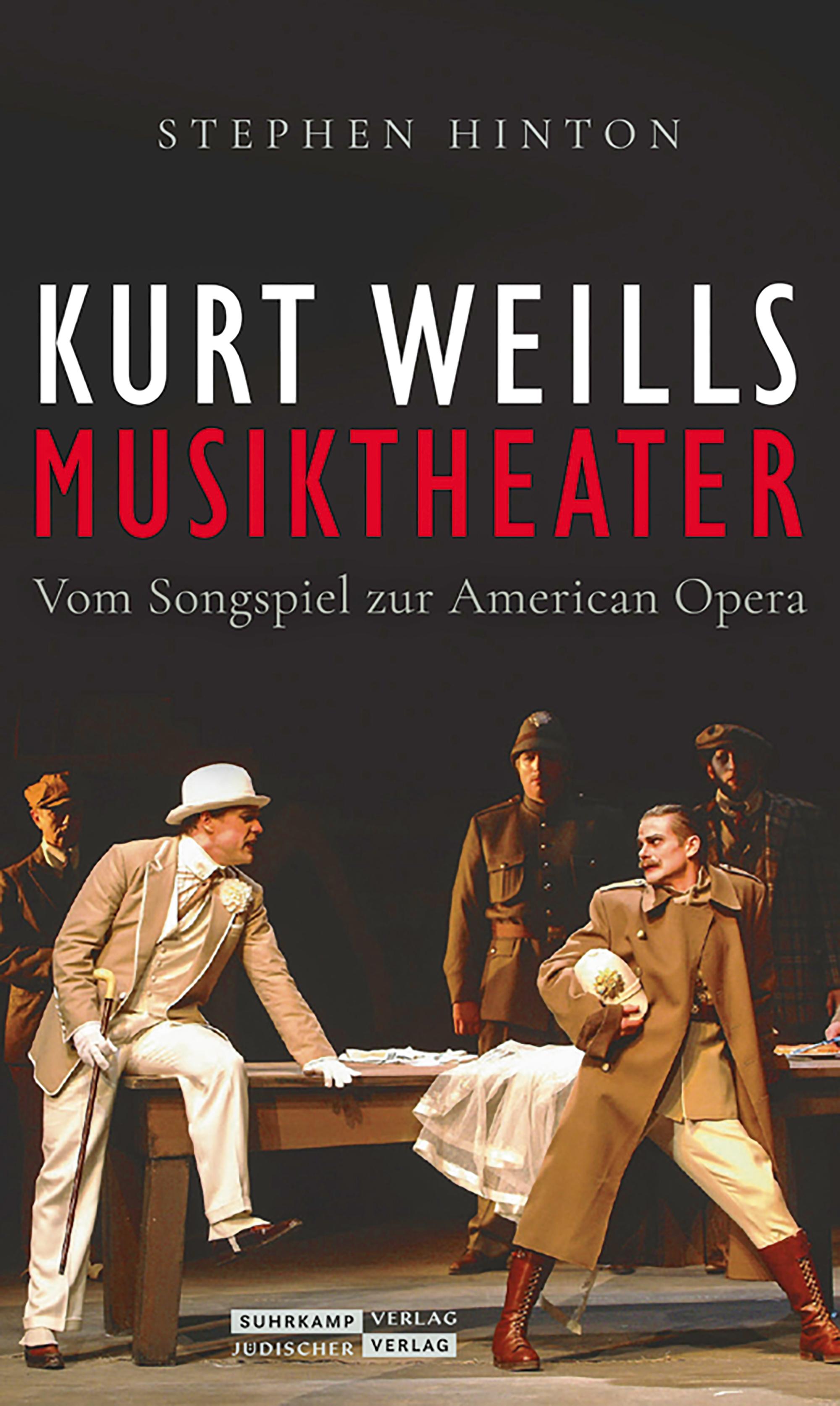
Von Kurt Weill sind schöne Bonmots überliefert wie das, mit dem er die für ihn unbrauchbare Unterscheidung zwischen Kunst und Unterhaltung zurückwies: „Es gibt nur gute und schlechte Musik“, so der vor allem als musikalischer Partner Brechts weltweit bekannte Komponist in einem Interview 1940. Es gibt noch eine andere, in der Weill-Forschung wie auch in der Theaterpraxis belegte Dichotomie, dass es nämlich einen deutschen und einen amerikanischen Weill gebe, dessen Werk, insbesondere das für Theater und Musiktheater, in diese beiden Kulturen zerfalle und dementsprechend bewertet werden müsse. Damit möchte der Germanist und Musikwissenschaftler Stephen Hinton in seinem Buch, das auf eine beinahe lebenslange Beschäftigung mit Weills Werk zurückgreifen kann, ein für alle Mal Schluss machen.
Es gibt keinen irgendwie aufteilbaren Weill, sondern nur einen für das Theater schaffenden Komponisten, der sich im Laufe seines doch kurzen Lebens (1900 geboren in Dessau, gestorben 1950 in New York) in den verschiedensten Genres von Musiktheater um Neuerungen bemühte und dies mit eigenen Werken vielseitig bekräftigte. Hintons zentraler Begriff ist „Reform“, den man nicht nur im landläufigen Sinne als Reformieren von etwas Überkommenem verstehen sollte, sondern der sich im Englischen auch als Um- oder Neuformen verstehen lässt.
Daher ist das Buch auch nicht biografisch aufgebaut – ein umfangreiches Anfangskapitel setzt sich gründlich mit den einschlägigen Weill-Biografien auseinander –, sondern nach Werktypen gegliedert. Einaktopern, Songspiel, Stücke mit Musik, Epische Oper, Lehrstücke werden bis zu den Darstellungen von Musical Plays, Filmmusik und American Opera vorgestellt und Weills „Reformierung“ jeweils untersucht. Der Grundstrom, mit dem Weill die Gegenwart „musikalisieren“ will, tritt deutlich hervor. Hinton gelingt dabei eine Werkgeschichte – die sich so übrigens auch als Handbuch benutzen lässt –, die nicht den Mustern eines jeweils kulturellen Kontexts folgt, sondern die Werke für das erneuerte Genre diskutiert. Ein Weill, der mit Brechts „Dreigroschenoper“ und „Mahagonny“ hervortrat, in Amerika aber ein Diener der Kulturindustrie geworden sei, wie Adorno über den trotzdem treffend als „Musikregisseur“ genannten Komponisten befand, das scheint Hinton mit seiner Zitierweise des Philosophen vornehm zu belächeln. Weill arbeitete in den USA mit den besten Theaterautoren für seine Musiktheaterstücke zusammen: Maxwell Anderson, Elmer Rice, Langston Hughes. Wie zuvor Brecht waren diese literarischen Arbeitspartner höchstes Niveau und nicht Kulturindustrie-Format.
Das alles behält Hinton bei seinen Werkanalysen stets im Blick, elegant formuliert und mit Quellen belegt. Ferruccio Busoni warnte seinem Schüler Kurt Weill, „die Furcht davor, trivial zu sein, ist für den modernen Künstler das größte Handicap“. Diese Krampfakt-Warnung hat auch der Musikwissenschaftler beherzigt, der sich nicht im allzu Spezialistischen verzettelt, Hintons Studie ist im Ton nie schwer akademisch.
Das Buch erschien 2012 in der University of California Press und wurde nun von Veit Friemert ausgezeichnet ins Deutsche gebracht. Zu ergänzen ist nur, dass aus den 1949 entstandenen Liedern zu Tom Sawyer und Huckleberry Finn inzwischen das Musical für Kinder „Tom Sawyer“ mit einem Libretto John von Düffels entstand, das 2014 am Deutschen Theater Göttingen uraufgeführt wurde und mittlerweile, von der Kurt Weill Foundation anerkannt, zu Weills Musiktheaterwerk gehört. Die 2023 an der Komischen Oper Berlin entstandene Inszenierung von „Tom Sawyer“ wurde gerade von der Oper Graz übernommen und ist dort im Mai und Juni zu erleben.
Stephen Hinton: Kurt Weills Musiktheater. Vom Songspiel zur American Opera, Suhrkamp Verlag Berlin 2024, 830 S., Gebundene Ausgabe € 58, E-Book € 49,99




.jpeg&w=3840&q=75)















