Gemeinsam/Allein
Publikum in digitalen Performances
von Doris Kolesch
Erschienen in: Recherchen 165: #CoronaTheater – Der Wandel der performativen Künste in der Pandemie (08/2022)
Assoziationen: Performance Dossier: Digitales Theater
Es hat sich zum geflügelten Wort entwickelt, die Corona-Pandemie als Brennglas für in unseren Gesellschaften vorhandene Probleme und Defizite zu sehen. Wir wussten es vorher, aber Corona hat in Deutschland (und nicht nur hier) den Rückstand mit Blick auf Digitalisierungsprozesse in Schulen, Verwaltungen und im Gesundheitssystem, aber auch mit Blick auf die ungleiche, auch im beginnenden 21. Jahrhundert noch immer einseitig geschlechtsbezogene Verteilung häuslicher Care- und Betreuungsarbeit oder auch bezüglich der massiv überfordernden und zu Lasten der Beschäftigten gehenden Zumutungen in der Betreuung kranker und/oder pflegebedürftiger Mitmenschen mit geradezu erschreckender Klarheit und Deutlichkeit vor Augen geführt. Ich möchte die Liste der virulenten gesellschaftlichen Problemlagen, die durch die Pandemie hervorgekehrt, zur Kenntlichkeit entstellt und geradezu vorgeführt wurden und werden, hier nicht weiter verlängern, sondern in diesem Beitrag nach dem fragen, was das Brennglas der Pandemie mit Blick auf die Publika der performativen Gegenwartskünste zum Vorschein brachte. Auch dies, das werde ich zu zeigen versuchen, ist nichts wirklich Neues, nichts, was uns gänzlich überraschen könnte, aber doch eine – wie ich denke – bemerkenswerte Akzentuierung und Verschiebung des Blicks und der Koordinaten.
Ich habe mein offenes, sich noch mitten in der Bewegung und Abwägung befindendes, keineswegs abgeschlossenes Nachdenken unter den Titel Gemeinsam/Allein...
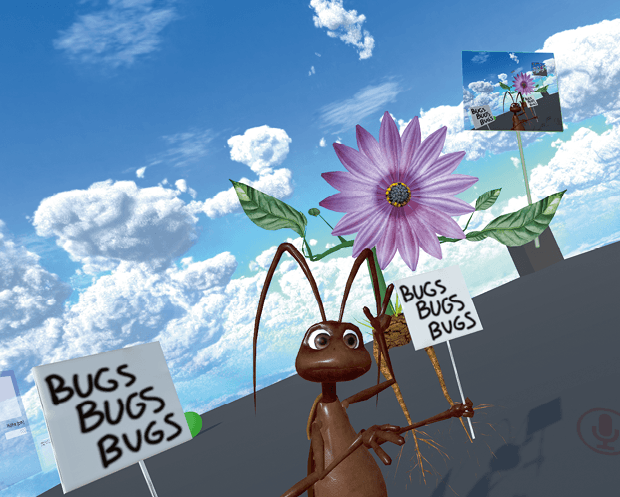
.jpeg&w=3840&q=75)















